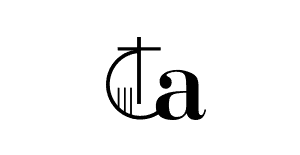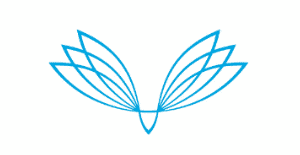Ende Oktober fand in Karlsruhe das Europäischen Treffen der Leitenden der Mennonitischen Konferenzen statt. Zur Sprache kam auch der Krieg in der Ukraine. Dabei kam es zu beeindruckenden Begegnungen mit einem Pastor von Mennonitengemeinden aus dem Kriegsgebiet. Jürg Bräker berichtet.
Roman ist Pastor und Vorsteher der Konferenz der Mennoniten-Brüdergemeinden in der Ukraine. In dieser Funktion nimmt er jedes Jahr am Europäischen Treffen der Leitenden der Mennonitischen Konferenzen (EMLC) teil. Zum ersten Mal dabei war 2014 beim Treffen in Lissabon. Sein Bericht von damals klingt wie das, was wir heute aus der Ukraine hören: Er berichtete von traumatischen Kriegserlebnissen und den Herausforderungen der Mennonitengemeinden, wenn junge Männer zu Kriegsdienst eingezogen werden, wenn Männer und Frauen im Kriegsgebiet unter Einsatz ihres Lebens Hilfe leisten. Schon 2014 war Krieg eine tägliche Wirklichkeit für unsere Schwestern und Brüder in der Ukraine. Auch wenn die Frontlinie weiter im Osten lag, betraf und beschäftigte sie der Krieg schon damals.
Eine Kirche, die sich für die Ärmsten einsetzt
Vier Jahre später lud Roman die EMLC nach Zaporischie ein, ein Ort, den ich damals noch auf der Landkarte suchen musste; heute steht er täglich in den Medien, er ist im Bereich der Frontlinie des heutigen Krieges. Auch 2018 erzählten die ukrainischen Geschwister von ihren wöchentlichen Transporten in die Kriegszone, aber auch von der Arbeit der Mennonitengemeinden, die sich für die Ärmsten in der Gesellschaft einsetzen. Wir besuchten beispielsweise ein Kirchengebäude in Molochansk, die in ein Altenheim umgewandelt worden war. Viele Menschen verarmen in der Ukraine im Alter. Einige von ihnen konnten in diesem Heim ein neues Zuhause finden. Von vielen ähnlichen Initiativen, auch für Jugendliche, von diakonischen Projekten in Zaporischie erfuhren wir; die Mennonit:innen versuchten dort zu helfen, wo der Sozialstaat nicht hilft. 2018 kam ich beeindruckt zurück von einer Kirche, die mit geringsten Mitteln, aber grossem Einsatz und enormer Kreativität, sich für die Ärmsten ihrer Orte einsetzt.
Hilfe leisten trotz Raketenbeschuss
Das diesjährige Treffen der EMLC fand vom 27. bis 30. Oktober 2022 in Karlsruhe statt. Ich fragte mich im Voraus: Würde Roman wieder teilnehmen können? Mittlerweile lebt er mit seiner Familie im Westen der Ukraine, koordiniert von dort aus die Hilfsarbeit und fährt selbst auch immer wieder zu den Gemeinden in den besetzten Gebieten und an die Frontlinie. Ja, Roman konnte für einen Tag in Karlsruhe dabei sein. Wieder erzählte er vom Krieg in der Ukraine. Von der Hilfe für jene, die nun täglich unter Raketenbeschuss und Angriffen stehen. Er berichtet, dass die Mennonitengemeinden zusammen mit anderen Kirchen vor Ort ein Netzwerk von Helfenden aufgebaut haben: Rund 200 Personen verteilen Essen und Medikamente, nehmen Geflüchtete auf, bringen sie, wenn möglich, in sicherere Gebiete und fahren mit Hilfsgütern zurück. Und auch diese Hilfeleistenden können jederzeit unter Beschuss geraten. Unfassbar für uns, die diese Wirklichkeit nicht kennen. Und wir merkten, wie schwer es ihm fiel, uns etwas davon zu vermitteln. «Wenn die Leute am Abend zu Bett gehen, wissen sie nicht, ob sie am nächsten Tag noch leben. Wenn eine Rakete auch in grösserer Entfernung einschlägt, ist man wie gelähmt. Es dauert lange, bis man sich wieder gesammelt hat und sich orientieren kann. Das hier» – er deutete aus dem Fenster in den sonnigen Park – «ist für mich so unwirklich, wie das Paradies.» Gemäss Roman verändern sich die Menschen unter dieser Dauerbelastung. Sie verlieren das Gefühl für die Gefahr und begeben sich nicht mehr in Schutz, wenn sich ein Beschuss ankündigt. Immer mehr Menschen zeigen zudem deutliche Zeichen von Traumatisierung, auch Helfenden aus dem Netzwerk der Kirche. Auch sie kommen oft nicht zurecht mit dem, was ihnen begegnet.
Allen beistehen, nicht töten
Wir fragten Roman, was es für die Mennonit:innen in der Ukraine heute bedeutet, als Friedenskirche in der Tradition des gewaltfreien Widerstandes in einem Krieg zu stehen. Roman erzählte von einer Situation, als ein Kinderspital von russischen Bomben getroffen wurde. Wenn Eltern in den Trümmern nach ihren Kindern suchen und nur einzelne Körperteile finden, seien das Bilder, die nur schwer auszuhalten seien. Dieser Beschuss habe bei den Menschen in der Ukraine etwas entscheidend verändert. Von da an hätten sich viele bewaffnet, um einem Feind entgegenzutreten und das Leben ihrer Kinder zu schützen. Wenn Kräfte zu solcher Vernichtung bereit seien, dann müsse man sich ihnen entgegenstellen, mit allen Mitteln. Dieser Umschwung habe auch in den Kirchen der Mennoniten zu viel Diskussionen geführt. Sie hätten sich gefragt: Ist es nicht auch die Pflicht, solch grauenhafte Angriffe zu verhindern? Ist hier nicht die Grenze unseres Bekenntnisses zur Gewaltfreiheit erreicht? Die Leitenden seien zu einer Einigung gekommen, zu der sie auch heute noch stehen würden, berichtet Roman: «Wir helfen allen, wo wir können: Geflüchteten, Menschen in Not in Häusern, Menschen, die zu uns kommen. Den Soldaten im Krieg, den körperlich und den seelisch Verletzten. Viele Pastoren dienen im Militär als Seelsorger. Wir beten mit den Kämpfenden, stehen ihnen bei in ihrer Angst. Wir stehen ihnen aber auch bei im Kampf mit sich selbst, wir ringen darum, dass sie und wir nicht dem Hass auf den Feind erliegen, wir kämpfen gegen die Versuchung, den Gegner nicht mehr als Menschen zu sehen. Wir helfen, wo wir können, allen. Aber wir töten nicht.»
Wirklichkeit des Krieges schränkt Handlungsmöglichkeiten ein
In der Frage: «Was heisst es, eine Friedenskirche zu sein in Zeiten eines Krieges wie dem in der Ukraine?» haben mir diese Berichte der Geschwister aus der Ukraine eine andere Perspektive vor Augen geführt. Mir wurde bewusst, dass die grossen Leitlinien eines Lebens in der Nachfolge Christi, im Dienst an seinem Frieden, unter dem gewaltigen Druck eines Krieges nicht ausgelöscht werden. Sie verschwinden nicht und bieten weiter Orientierung. Doch in der Wirklichkeit des Krieges sind in konkreten Situationen die Handlungsmöglichkeiten oft sehr eingeschränkt. Da entscheiden nicht die abstrakten Debatten über die Möglichkeiten von gewaltfreiem Widerstand, sondern die Grundhaltungen, die ich schon lange eingeübt habe. Diese Grundhaltungen können zwar durch die Debatten der Friedenstheologie genährt werden. Aber oft können sie die Fragen der Dilemmas nicht beantworten, in die wir durch die Gewalt eines Krieges gestossen werden. Sie antworten nicht auf die Frage: «Ist es erlaubt, zum Schutz der Freiheit, zum Schutz von völliger Vernichtung, zu Gewalt zu greifen?» Aber sie geben Orientierung in den wenigen Entscheidungen, die mir im konkreten Leben zufallen: Versuchen, das weiterzuleben, wozu ich mich berufen sehe.
Trauma-Arbeit ist Friedensarbeit
Im Rahmen des Treffens in Karlsruhe haben wir unter uns auch die Frage diskutiert, was es für unsere mennonitischen Konferenzen heisst, in diesen Zeiten des Krieges Friedenskirche zu sein. Die Fragen des Dilemmas eines Krieges blieben und bleiben schwierig zu beantworten. Doch in einem Punkt waren wir uns alle einig: Wir sollten uns darauf vorbereiten und wenn möglich schon jetzt aktiv werden, um den vielen Traumatisierten beizustehen. Trauma-Arbeit ist Friedensarbeit. Friedensarbeit ist es auch, in den Zerspaltungen, in die ein solcher Krieg ganze Völker stürzt, den Dienst der Versöhnung anzubieten. Das sind grosse Worte. Doch die Helfenden, die Seelsorger:innen und Pastor:innen der ukrainischen Gemeinden, stehen schon in diesem Dienst. Wir können sie schon jetzt unterstützen, ihren Erfahrungen zuhören, ihre Verzweiflung teilen, mit ihnen um gangbare Wege ringen. Und da sind ja auch die Kirchen aus anderen Weltgegenden, die Erfahrungen haben, wie in solchen Zerspaltungen auf Versöhnung hingearbeitet werden kann. Auch das sind Ressourcen, die wir anbieten können.
Text:
Jürg Bräker