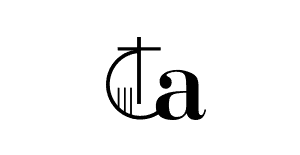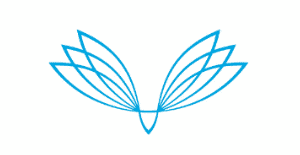Wie geht die täuferisch-mennonitische Kirche als Friedenskirche mit Gewalt um, für die sie selbst verantwortlich ist? Diese Frage stand im Zentrum eines Treffens von Theologiestudierenden aus mennonitischen Kirchen, das Ende April in Hamburg stattgefunden hat. Jürg Bräker, Generalsekretär der Konferenz der Mennoniten der Schweiz, blickt zurück.
«Irgendwas übersehen wir hier!» ist einer der häufigsten Sätze in zahlreichen Fernsehkrimis. Manchmal liegt etwas offensichtlich vor Augen und doch übersehen wir es, weil wir die wesentliche Frage nicht stellen. Es ist nicht so einfach, im eigenen Blick auf die Wirklichkeit den blinden Flecken auf die Spur zu kommen. Die Gruppe von rund 30 Theologiestudierenden, die sich vom 21. bis am 24. April 2022 in Hamburg mit dem Thema «Mennonite Innocence?» befasste, versuchte es – mit teilweise überraschenden und berührenden Ergebnissen. Dabei waren es nicht nur Mennonit:innen aus Europa, die sich zum europäischen Treffen von Theologiestudierenden trafen. Zur Gruppe gehörten auch Studierende aus anderen Denominationen und neben Studierenden aus den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz, auch Studierende aus USA, Kanada und Indonesien. Dieser internationale und interdenominationelle Mix erwies als hilfreich in der Spurensuche.

Mennonitische Unschuld?
Der Begriff der «White Innocence», geprägt von der afro-surinamesisch niederländischen Anthropologin Gloria Wekker, setzte das Thema der Tagung. Andres Pacheco Lozano, Post-Doc an der Vrije Universiteit Amsterdam, bezog sich auf den Ansatz von Gloria Wekker, in dem diese feststellt, dass Weiße oft ihren eigenen Rassismus übersehen. Sie nehmen ihr Weiß-Sein nicht als Färbung wahr und übersehen, dass die damit verbundenen Privilegien ihren Blick auf die Gesellschaft einfärben. Auf den latenten Rassismus angesprochen, reagieren sie empfindlich und verteidigend («Wir sind doch tolerant und keine Rassisten!») und keineswegs neutral. Diese weiße Zerbrechlickeit / Empfindlichkeit («White fragility») weist häufig auf blinde Flecken in der Selbstwahrnehmung hin. Von diesem Konzept ausgehend stellten wir uns im Austausch im Rahmen der Tagung die Frage, ob es in der Mennonitischen Selbstwahrnehmung auch so etwas wie eine «Mennonite Innocence» in Bezug auf Gewalt und Schuld gibt. Die Selbstdarstellung als Friedenskirche kann dazu verführen, Gewaltanwendung durch die Gemeinschaft oder in der Gemeinschaft jeweils als Ausnahme von der eigentlichen Identität darzustellen. Gewalt wird zwar nicht unbedingt geleugnet, aber auch nicht mit der eigenen Identität verbunden und schon gar nicht als etwas gesehen, das aus ihr hervorgegangen sein könnte. Diese Selbsterzählung kann dazu führen, dass wir übersehen, wie die eigene Gruppe Prozesse in Gang setzt, die andere viktimisiert. Dabei wird sie selbst zur Täterin von Gewaltausübung.
Übung macht prägendes Narrativ sichtbar
Wie prägend dieses Narrativ einer Kirche ist, die sich der Gewalt enthalten möchte, wurde für uns in der ersten Übung der Tagung sichtbar. Auf die Frage hin: «Wie erzählt ihr, wer wir sind?», wurde meist genannt: «Die Mennoniten gibt es nicht, da ist eine Vielfalt», um dann doch ebenso durchgehend in die Aufzählung einzufügen, dass Erzählungen von Verfolgung und das Erleben, dass man Gewalt erlitten hat, sich eng mit dem Anliegen verbinden, eine Friedenskirche zu sein. Das Narrativ von dissidentem Glauben und entsprechender Unterdrückung, sowie das Bekenntnis, dass wir Gewalt überwinden und nach gewaltfreien Konfliktlösungen suchen möchten, – dieses Narrativ hält sich in den Ursprungs- und Identitätserzählungen trotz der Vielfalt von «die Mennoniten gibt es nicht» dann doch erstaunlich konsistent durch und wird auch von anderen Denominationen so wahrgenommen.
Die Sache mit dem Opfer: Victim und Sacrifice
Um den Zusammenhängen von Opfer- und Täterzuschreibungen auf die Spur zu kommen, ging Marie Anne Subklew, Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Arbeitsstelle Theologie der Friedenskirchen der Universität Hamburg, in ihrem Beitrag der Verwendung von Begriffen wie «sacrifice»/«sacrificium»», «victim» (im Deutschen beides Opfer) sowie Märtyrer in den biblischen Schriften nach. Zudem zeigte sie auf, wie diese im Zusammenhang von Kriegen und Kriegsgedenken als religiöse Sprache erscheinen. Alle sind verbunden mit Lebenshingabe oder zumindest der Hingabe von etwas sehr Wertvollem. Während «sacrificium» meist eine freie Lebenshingabe aus eigenem Willen meint, erscheint «victima» in den biblischen Schriften wenig, meist als Bezeichnung für ein zu schlachtendes Tier und betont so den Aspekt der Zerstörung und Vernichtung von Leben. Betrachtungen der Begriffe im Zusammenhang von Krieg brachten zutage, dass sehr oft Opfer im Sinne von «sacrificium» («… der sein Leben hingibt für die Freunde») gefordert werden. Dabei blendet diese Stilisierung zum «sacrificium» zwei Aspekte aus: Zum einen, dass Personen, die ein solches Opfer bringen, selbst auch Täter sind und andere zu Opfern im Sinne von «victima» machen. Sie vernichten deren Leben und stellen nicht nur ihres eigenes zur Verfügung. Zum anderen wird durch die Stilisierung ausgeblendet, dass diese Personen meist selbst Opfer im Sinne von «victima» sind. Denn die Rede von «sacrificium» täuscht eine freiwillige, Idealen verpflichtete Selbsthingabe vor und blendet damit die Viktimisierung der Soldaten aus, die dahintersteckt. Diese werden häufig unfreiwillig in die «Lebenshingabe» gezwungen, sei es aus wirtschaftlichen Gründen oder sozialer Stellung. Der Begriff des Martyriums kommt ins Spiel, wenn die Aggression primär einem Feind zugeschrieben wird, welcher die Verteidigung der eigenen Ideale notwendig macht. Seine Aggression macht die Getöteten zu «victims» seiner Aggression, aber durch ihre Verpflichtung an die verteidigten Ideale («sacrificium») werden sie zu Märtyrern, die ihr Leben für die gute Sache hingeben. Diese Ausführungen lieferten eine wichtige Grundlage, die Zusammenhänge in Opfer und Täterschaft in den Narrativen mennonitischer Identität differenzierter anzugehen.
Welche Geschichten werden nicht erzählt?
Astrid von Schlachta, Historikerin an der Forschungsstelle für Täufergeschichte auf dem Weierhof und an der Arbeitsstelle für Theologie der Friedenskirchen in Hamburg, griff in ihrem Beitrag einige Beispiele aus der Geschichte auf, welche die Narrative rund um unsere Identität kritisch beleuchteten. Die Beispiele zeigten auf, dass Gewaltanwendung in mennonitischen Kreisen und durch Mennoniten sehr wohl vorkam. Diese wurden aber rückblickend meist als Entgleisungen wahrgenommen und von der wahren mennonitischen Identität abgehoben. Anschließend versuchten wir während einem Besuch in der Menno-Kate bei Bad Oldesloe, die Geschichtserzählung im dortigen Museum unter dem Blickwinkel der vorangegangenen Diskussionen zu lesen. Was prägt die Selbstdarstellung? Welche Geschichten werden nicht erzählt? Die konzentrierte und kurz gefasste Erzählweise erfordert natürlich, dass ausgewählt werden muss, was hauptsächlich zur Erzählung gehört; dadurch macht es aber auch sichtbar, was man zu den Kernpunkten der Identität zählt.
In ähnlicher Form setzten wir uns später mit den Erzählungen auseinander, wie sie im Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold erzählt wird. Heinrich Wiens, im Museum verantwortliche für den Bereich Bildung, führte in die auch virtuell zugängliche Ausstellung ein. Und wieder die Frage: Welche Geschichten fehlen? Und hier kamen nun die Überlegungen und Analysen persönlich nahe. Für mich war nach einigen Videos schnell klar: Wenn davon erzählt wird, wie die Zarin Katharina die deutschen Siedler einlädt, Land und Privilegien verteilt, wird die Geschichte jener nicht erzählt, die das Land ohne diese Privilegien bearbeiten mussten. Die Leibeigenen, die verzögerten Landreformen und die Leibeigenschaft wird kaum in Verbindung gesetzt mit der Siedlungsgeschichte der Mennoniten in diesen Ländereien.
Doch als Heinrich Wiens nachfolgend Einblick gab in die Autobiographien russlanddeutscher Mennoniten, wurde nochmals eine andere Dimension sichtbar: Die Darstellung der Geschichte der Russlanddeutschen ist vor allem auch Erinnerungsraum für die unfassbar leidvollen Geschichten der unter Stalin Verschleppten, von denen viele die Gefangenschaft in den Gulag, gebrandmarkt als Volksverräter, nicht überlebten. Das Erzählen wird zu einem Weg, die Würde, die trotz des großen Leids in diesen Leben liegt, zum Ausdruck zu bringen, aussprechen zu können, dass das Erlittene Unrecht war und die Spuren der Bewahrung durch Gott sichtbar zu halten und zu bezeugen.
Diese Ausführungen machten mir bewusst, was ich zuvor übersehen hatte: Wie wichtig in unseren Erzählungen die Suche nach der Würde des eigenen Lebens und dem Leben anderer ist. Blinde Flecken benennen braucht Behutsamkeit. Zudem müssen die Erzählenden selbst mitbestimmen können, wann es an der Zeit ist, auch problematische Aspekte der eigenen Geschichte in den Blick zu nehmen. Wenn Heilung von Erinnerungen und Gemeinschaften geschehen soll, dann muss auch das Aufdecken von blinden Flecken diese Heilung zum Ziel haben.

Jürg Bräker ist Generalsekretär der Konferenz der Mennoniten der Schweiz und ist als theologischer Mitarbeiter bei der Evangelischen Mennoniten-Gemeinde Bern angestellt.
Wie erzählen wir in Zukunft unsere Geschichte?
Als Generalsekretär der Konferenz der Mennoniten der Schweiz erzähle ich oft vor anderen Glaubensgemeinschaften Geschichten unserer Identität. Nach den Entdeckungen an diesem Treffen möchte dies unter folgenden Perspektiven tun:
- Ich möchte die Geschichte erstens so erzählen, als säßen jene, über die ich erzähle, mit am Tisch. Ich möchte mitbedenken, was meine Ausführungen bei ihnen auslösen könnten. Und ich möchte so erzählen, dass die Erzählungen Schritte auf dem Weg zur Heilung der Erinnerungen und der involvierten Gemeinschaften werden können.
- Dies bedeutet, dass ich immer auch frage: Wer fehlt hier am Tisch? Wessen Geschichte wird verschwiegen und müsste auch Gehör finden? Wer gehörte und gehört dazu und wurde bisher übersehen? Denn auch diese Erinnerungen gehören auf den Weg der Heilung.
- Und drittens möchte ich wie am Beginn eines Mediationsgesprächs die Beteiligten selbst darüber entscheiden lassen, was auf den Tisch kommen soll. Wenn ich meine eigenen blinden Flecken ans Licht hole, erhoffe ich, dass die vollständigere Wahrheit für alle befreiend wirken wird. Doch wo ich anderen ins Dunkel zünden möchte, ist die Unterscheidung zwischen Empfindlichkeit, Zerbrechlichkeit, Verletzlichkeit und Verwundbarkeit zentral. Wenn jemand in einer mit Privilegien ausgestatteten Position ist, kann es durchaus angebracht sein, diese anzutasten und danach zu fragen, wie diese Privilegien die Sicht verzerren. Es kann dann durchaus heilsam sein, wenn diese von Privilegien geprägte Sichtweise zerbröckelt. Wenn es aber um den Blick auf Geschichten geht, die traumatisierend waren, entscheiden jene darüber, die sich als Opfer (victim) erlebt haben, wann sie bereit sind, auch schwierige Aspekte, die noch im Dunklen liegen, ans Licht zu holen.
So war es passend, dass die Tagung mit einem Abendmahlsgottesdienst schloss. Die Teilnehmer:innen des Treffens teilten Erfahrungen und Erkenntnisse des Treffens im Gottesdienst mit der Mennonitengemeinde zu Hamburg und Altona und brachten sie so wieder mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten in Verbindung. Die Feier ließ erleben: In beidem, mit dem, was wir erinnern und erzählen, und mit dem, was unbenannt bleibt, bleiben wir gehalten im Gedenken Gottes, der sich unser mit Erbarmen erinnert.